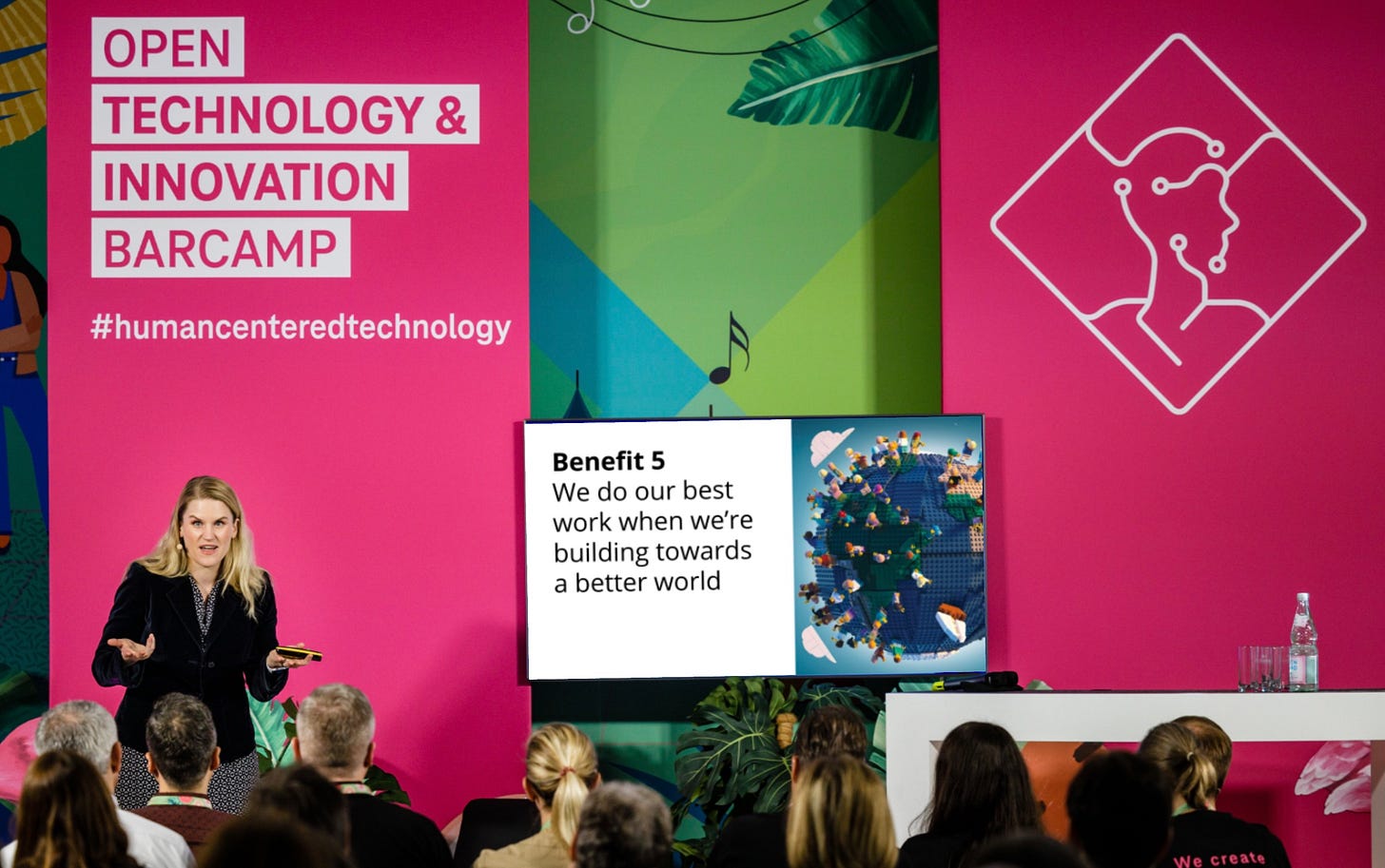🌱 #DRANBLEIBEN (Denkanstoss)
#141: Digitale Verantwortung oder digitale Katastrophe? Warum dieses Thema heute wichtiger ist denn je
Willkommen zu einer besonderen Ausgabe!
Bisher habe ich bei DRANBLEIBEN vor allem Inhalte kuratiert und geteilt, die ich finde und die mich bewegen. In Zukunft wird es hier nun verstärkt auch um meine eigenen Gedanken, Einschätzungen und Ideen gehen – über Themen, die mir besonders am Herzen liegen.
Ich bin überzeugt: Gerade persönliche Perspektiven können einen echten Mehrwert schaffen. Deshalb werde ich sie noch expliziter und tiefer behandeln – aus meiner Sicht, mit meinen Erfahrungen, mit meinen Vorstellungen. Das ist die „Denkanstoss”-Variante des Newsletters.
Ich freue mich auf deine Gedanken, deine Perspektiven und den Austausch darüber!
Warum digitale Verantwortung heute wichtiger ist denn je
Hiermit geht es los. Denn dieses Thema begleitet mich seit vielen Jahren - hat mich in den letzten Wochen und Monaten aber in besonderer Weise beschäftigt. Um besser zu verstehen, was mich hier bewegt, möchte ich dich zuerst mitnehmen auf eine Reise. Auf eine Entwicklung voller Begeisterung, Erkenntnisse und auch kritischer Momente. Auf meinen Weg, der immer von Technologie geprägt war. Und der mich heute zu der Überzeugung geführt hat: Digitale Verantwortung ist wichtiger denn je.
Ich bin ein Commodore-Kind der 80er und ein PC- und Internetkind der 90er Jahre. Meine Generation war die letzte, die einen Teil ihrer Kindheit noch analog erlebte – bevor digitale Technologien und das Internet unseren Alltag zunehmend prägten.
Seit dem ersten Fiepsen meines Modems, und seitdem ich mein erstes (unter schwierigen Umständen organisiertes) Exemplar des WIRED-Magazins in den Händen hielt, war ich fasziniert von dieser neuen Welt. Silicon Valley und das MIT wurden zu Sehnsuchtsorten für mich. Technologie hielt ich für grenzenlos. Voller Möglichkeiten. Exponentiell wachsend. Für mich stand fest: Ich wollte Teil dieser Entwicklung sein. Mein Ziel war es, beruflich in der Tech-Welt anzukommen – vielleicht sogar im Silicon Valley, dem Zentrum der digitalen Innovation.
Aufbruch in die Tech-Welt
Und schließlich wurde mein Traum Realität. Mein Weg führte mich über Startups in Köln und London, über T-Mobile und die Deutsche Telekom – über Orte und Unternehmen, wo an der digitalen Zukunft gearbeitet wurde. Themen wie E-Commerce, mobiles Internet und Virtual Reality begleiteten mich auf diesem Pfad. Ende der 2000er Jahre ging es tatsächlich ins Silicon Valley – zu Yahoo, damals ein Pionier in der Gestaltung des mobilen Internets. Ich wurde Teil dieses Bleeding-Purple-Teams, lebte in San Francisco, pendelte täglich mit dem Firmenbus ins Valley – und saugte alles auf, was diese faszinierende Welt zu bieten hatte.
Doch je länger ich in diesem Epizentrum der digitalen Welt war, desto mehr begann mein ursprüngliches Bild zu bröckeln. Es war nicht nur Faszination, die ich spürte – sondern auch erste Irritationen und Zweifel.
Von der Euphorie zur Klarheit: Ein Wendepunkt
Das Valley war voller intellektuell brillanter Menschen aus aller Welt. Aber auch voller „Goldgräber“ (Gendern an dieser Stelle nicht nötig...) ohne erkennbares Gewissen. Und damit auch voller Widersprüche. Wachstum galt grundsätzlich als Erfolg. Innovation wurde gleichgesetzt mit Fortschritt. Disruption war per se etwas Gutes. Aber viel zu oft fehlte mir die entscheidende Frage: Für wen ist dieser Fortschritt eigentlich gut? Wer profitiert davon? Wer nicht? Und wer trägt die Verantwortung für die Nebenwirkungen? Die Naivität, mit der viele die gesellschaftlichen Debatten ausblendeten, irritierte mich damals schon. Besonders auffällig war die Hybris vieler Menschen aus dem Umfeld der großen Tech-Konzerne. Die „Masters of the Universe“-Attitüde, ick hörte dir trapsen... Schon damals hatte ich das Gefühl, dass dieser grenzenlose Glaube an die eigene Unfehlbarkeit gefährlich werden könnte – lange bevor sich in den 2010er Jahren zeigte, wie sehr genau dieser Geist die digitale Welt aus den Fugen geraten ließ.
Mein europäischer Antrieb
Schließlich kehrte ich nach Europa zurück. Meine Erfahrungen im Valley hatten meinen Blick geschärft – auf das, was mich wirklich ausmacht. Und was ich wirklich suche. Meine Identität als Europäer wurde in dieser Zeit gestärkt. Ich wusste: Ich wollte dazu beitragen, Technologie weiterzuentwickeln – aber in einem anderen Wertesystem. In einem, das mehr darauf ausgerichtet ist, uns Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. In einem System, in dem gesellschaftliche Verantwortung und Gemeinwohl nicht völlig irrelevant sind.
Zunächst arbeitete ich weiter an neuen digitalen Diensten, in einem Markt, der sich rasant weiterentwickelte: von E-Commerce Diensten, über digitale Lifestyle-Accessories, über Software-as-a-Service Angebote, das Internet der Dinge und das Smarte Zuhause, bis zu Mobile Device-Innovationen im Einzelhandel und zu neuen Breitband-Erlebnissen in der Luftfahrt.
Von der Zukunftsmodellierung zur digitalen Realität
Doch mit der Zeit verschob sich mein Fokus: weg von der reinen Umsetzung, hin zu einem tieferen Nachdenken über die Zukunft digitaler Technologien, und zur Modellierung von Zukunftsszenarien. Und zu der Frage, wie Technologie sinnvoll und menschenzentriert gestaltet werden kann.
Doch während ich mich intensiv mit dem Wünschenswerten beschäftigte, zeigte die Realität ein anderes Bild: In der zweiten Hälfte der 2010er Jahre brach eine Welle von Skandalen über die Öffentlichkeit herein. Cambridge Analytica und Facebook, die Enthüllungen über die Arbeitsbedingungen bei Amazon, Facebooks Rolle bei der Verbreitung von Fake News, die toxischen Mechanismen der YouTube-Algorithmen – sie machten deutlich: Es ging längst nicht mehr nur um technische Innovation. Es ging um grundlegende gesellschaftliche Fragen.
Technologie – und die Menschen, die sie gestalten – beeinflussen unser Leben in einem Ausmaß, das ich damals unterschätzt hatte. Wie so viele andere auch. Mir wurde klar: Wenn wir die Zukunft nicht aktiv gestalten, tun es andere. Oft ohne Rücksicht auf gesellschaftliche Folgen. Und diese Folgen sind gewaltig.
Die kontinuierliche Übernahme unserer Zukunft
Die negativen Auswirkungen des Wettlaufs um unsere Aufmerksamkeit und Bildschirmzeit sind heute unübersehbar – und sie erschüttern unsere Gesellschaften tief. Algorithmen sind darauf optimiert, uns Menschen so lange wie möglich in digitalen Umgebungen zu halten – oft ohne Rücksicht auf ihr Wohlergehen.
Die sozialen, psychologischen, politischen, gesellschaftlichen Folgen dieses Systems sind gravierend.
Parallel dazu wuchs das Vermögen der Männer hinter den erfolgreichsten Tech-Unternehmen in schwindelerregende Höhen: vom einstelligen in den zweistelligen, schließlich in den dreistelligen Milliardenbereich. Der erste Tech-Billionär scheint nur noch eine Frage der Zeit.
Für mich wurde immer klarer: Die falschen Menschen mit fragwürdigen Wertesystemen gewinnen immer mehr Macht – gestalten unser Leben, prägen unsere Zukunft. Und wandeln ihre finanzielle Macht zunehmend in politische Macht um.
Vom Beobachten zum Handeln: Mein Schritt in die digitale Verantwortung
Als die Technologie-Skandale und ihre Folgen immer stärker ins öffentliche Bewusstsein rückten, stand für mich fest: Ich wollte meinen eigenen Beitrag in diesem Ökosystem neu ausrichten. Nach Jahren praktischer Arbeit und strategischer Gestaltung entdeckte ich eine neue Leidenschaft: Kommunikation und Storytelling – als Werkzeuge, um technologische Entwicklungen nicht nur zugänglicher, sondern auch bewusster und menschlicher zu machen. In einer neuen Rolle, nah an den Tech & Innovation Entscheidungszentren der Deutschen Telekom, konnte ich diese Leidenschaft entfalten: Ich half dabei, Technologie verständlich zu machen – nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel für etwas Größeres.
Doch schnell stand für mich fest: durch mich geprägte Kommunikation soll nicht nur vermitteln. Sie soll Haltung zeigen. Und genau deshalb wollte ich mehr: nicht nur erklären, sondern auch prägen – und mich aktiv für digitale Verantwortung und Technologieethik einsetzen. Innerhalb der Deutschen Telekom hatte ich das Privileg, eine Graswurzelbewegung aufzubauen, die Menschen – und damit auch das Unternehmen – genau in diesen Themen stärkt. Ein Schlüsselmoment war unsere Auftaktveranstaltung mit der Facebook-Whistleblowerin Frances Haugen in 2022. Auf einem ihrer Charts stand:
Und genau das ist mein Purpose, mein Antrieb. Ich bin viel zu überzeugt von den positiven Möglichkeiten der Technologie, als dass wir unsere Zukunft bedenkenlos den Tech-Dudes aus dem Silicon Valley überlassen dürften. Deshalb will ich Menschen begeistern, gemeinsam eine positive (digitale) Zukunft zu entwickeln und umzusetzen.
Meine Erfahrungen als “Tech-Ethics Advocate”
War das immer einfach - immer ein Selbstgänger? Nein. Meine Erfahrungen als Verfechter und Förderer von Tech-Ethik und digitaler Verantwortung im Corporate Umfeld lassen sich - wenn es kurz sein soll - so zusammenfassen: Das resoniert bei vielen. Ist aber auch abstrakt für viele andere. Soll heißen: Da sind Mitarbeitende und Führungskräfte, für die verantwortliches Handeln im Umgang mit Technologie selbstverständlich ist. Da wird Technologie nicht als Selbstzweck verstanden. Sondern als nützliches und wertvolles Werkzeug für uns Menschen. Um damit für uns relevante Anliegen in den unterschiedlichsten Lebenslagen und Kontexten zu adressieren. Von etwas fast Profanem wie „mehr Komfort“ über Wichtiges wie „mehr Sicherheit“ bis hin zur Lösung der ganz großen Herausforderungen der Menschheit.
Es gibt aber eben auch viele Menschen, für die „Ethik“ oder „Humanismus“ abstrakte Begriffe sind. Die natürlich nichts Böses im Schilde führen, aber die Verbindung zwischen diesen Werten und einem traditionellen Arbeitsalltag nicht selbstverständlich sehen und umsetzen. Da gibt es gibt diejenigen, denen das Thema fremd ist, weil sie in einem sehr traditionellen unternehmerischen Denken verhaftet sind. Die befürchten, dass digitale Verantwortung und Tech-Ethik „dem Geschäft schaden“ (obwohl das Gegenteil der Fall ist). Oder es gibt diejenigen, die nur oberflächliche, unkritische Erfolgsgeschichten und „Feel-Good-Narrative" hören wollen. Die sich unwohl fühlen, wenn es um Probleme und Herausforderungen geht. Menschen, die Buzzwords wie „Innovation" und „Disruption" tatsächlich so verinnerlicht haben, dass alles immer positiv sein muss. „Warum macht ihr die Technologie so schlecht?", fragte mich letztes Jahr jemand, als ich eine Open-Space-Diskussionsgruppe zum Thema „Bewusstsein für die Herausforderungen der Vermenschlichung von Technologie" moderierte.
KI: Hilfe - aber auch Bürde
Die Förderung von digitaler Verantwortung und die Stärkung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich dafür einsetzen, ist deshalb - kaum verwunderlich - ab einem gewissen Punkt eine Herausforderung. Es ist ein ganz anderer Schwierigkeitsgrad, als Initiativen und Communities anzutreiben, die die „alle machen jetzt KI“-Sau durchs Dorf treiben (wenn ich das mal despektierlich sagen darf - denn chancenorientiert und neugierig auf KI zu schauen, Neugier zu fördern um damit zu arbeiten, das ist natürlich wichtig ... und kann und sollte Hand-in-Hand mit Initiativen für digitale Verantwortung gehen).
Das Zusammenspiel von KI und digitaler Verantwortung ist insgesamt ein besonderes und zweigeteiltes: Denn eine so wirkmächtige Technologie wie KI macht auf der einen Seite die Bedeutung eines ethischen Umgangs mit ihr sehr plastisch verständlich und greifbar. Auf der anderen Seite zieht der Hype um das Thema KI aber auch erst Recht Menschen und Aufmerksamkeit an und schürt „fear of missing out / fear of being left behind” Ängste. Die dann kritische Perspektiven erst Recht gerne an den Rand drängen („Wieso auch kritische Aspekte von KI beleuchten, wenn das Leadership der KI so viel wuchtige Bedeutung beimisst?”)
2025: Der harte Blick auf die Realität
Hier schließt sich der Kreis zu meinem Eingangsstatement: Warum ist digitale Verantwortung heute wichtiger denn je? Heute – im aufgewühlten Jahr 2025 – zeigt sich klarer als je zuvor: Die digitale Welt entwickelt sich nicht automatisch in eine positive Richtung. Die Missstände in der Tech-Industrie verschwinden nicht. Sie verschärfen sich. Die Macht weniger Monopol- oder Oligopolunternehmen wächst weiter. Der Einfluss von Big-Tech-Lobbyismus auf politische Entscheidungen in den USA nimmt dramatisch zu. Dieser Einfluss wird auch genutzt, um Druck auf Europa auszuüben. Techno-autokratische Entwicklungen, enge Verstrickungen zwischen Politik und Big Tech und das Sichtbarwerden kruder, menschenverachtender Ideologien – tief verwurzelt im Silicon Valley – zeichnen ein düsteres Bild.
Meine Ableitung: Digitale Verantwortung ist keine Kür. Sie ist absolut notwendig.
Notwendig für uns – in unserer Rolle als Arbeitende.
Notwendig für uns – in unserer Rolle als Konsument*innen.
Und vor allem notwendig für uns – in unserer Rolle als Bürger*innen und Bewohner*innen dieses Planeten.
Was in den letzten Monaten an Hüllen gefallen ist, bestärkt mich in meiner Überzeugung: Der Weg der Tech-Ethik und der digitalen Verantwortung, basierend auf einem europäischen Wertesystem, ist der einzig richtige Weg. Nicht diejenigen hatten den besseren Riecher für eine gute Zukunft, die in den letzten Jahren Missstände heruntergespielt haben (diese Menschen sind mir oft genug über den Weg gelaufen). Sondern diejenigen, die sich nicht gescheut haben, hinzusehen, Missstände anzusprechen und Wege zu einer besseren digitalen Zukunft aufzuzeigen.
Unsere Verantwortung - und vor allem: unsere Chance!
Bei aller Fassungslosigkeit über die aktuellen Entwicklungen fühle ich mich in meiner Mission bestärkt. Mein Weg begann einst als durchaus naiver Technikfanboy – überzeugt davon, dass Technologie faszinierend ist und nur Gutes bewirken würde. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass uns das exponentielle Wachstum digitaler Technologien jemals an den Rand techno-autoritärer Dystopien bringen könnte. Ich hätte nicht geglaubt, dass einige Unternehmen bei aller berechtigten Gewinnorientierung ihre gesellschaftliche Verantwortung so wenig ernst nehmen – oder sie sogar aktiv negieren würden. Ich bin hier durch ein tiefes Tal der Erkenntnis gegangen.
In der aktuellen Situation liegt für mich zweierlei: eine große Verantwortung – aber auch eine enorme Chance. Als Europa, als Europäer*innen. Wir scheinen der letzte verbliebene Machtblock zu sein, in dem freiheitlich demokratische Werte als Grundlage für unser Leben und Wirtschaften selbstverständlich sind. Aber unter Beschuss geraten. Wir müssen uns von Entwicklungen wie in den USA deutlich abgrenzen. Wir müssen es besser machen. Und wir müssen es jetzt machen.
Alternativen im Hinblick auf Technologie und wie sie entwickelt und angewendet wird, gibt es längst: Unternehmen mit klaren ethischen Leitplanken.
Europäische Regulierung – bei weitem nicht perfekt, aber getragen von einem humanistischen Menschenbild. Gemeinwohlorientierte Plattformen. Ethisch gestaltete Algorithmen. Menschenzentrierte digitale Räume. All das existiert – oder entsteht gerade. Bisher fehlte der Moment, um diese Alternativen in den Mainstream zu holen. Jetzt ist dieser Moment da.
Das kann – und muss – ein Wendepunkt sein. Für eine digitale Zukunft, die nicht von einer kleinen Elite im Silicon Valley bestimmt wird, sondern von Menschen und Organisationen, die sich Werten wie Gerechtigkeit, Teilhabe und Verantwortung verpflichtet fühlen. Wir brauchen neue Ideen. Neue Geschichten. Wir müssen uns wieder auf das besinnen, was uns Menschen ausmacht: Vorstellungskraft. Phantasie. Eine der mächtigsten Waffen, die wir haben – und die nichts kostet – ist die Vorstellung von einer besseren Zukunft. Und genau daran möchte ich mitarbeiten – und dich und euch inspirieren, gemeinsam neue Wege auf eine bessere Zukunft hin zu gehen.
Es geht um viel mehr als Technologie
Zum Abschluss kommend ist mir wichtig zu betonen, dass diese Logik übrigens nicht nur für unseren Umgang und unsere Arbeit mit Technologie gilt. Nein, es geht nicht nur um Technologie. Nicht nur um Technologieethik. Und auch nicht nur um eine Rückbesinnung auf den Humanismus. Es geht um viel mehr. Es geht um weitere zentrale Herausforderungen, die wir als Menschen – und besonders wir als Europäer*innen – dringend anpacken müssen. Dazu gehören auch:
Die Transformation unserer Wertschöpfungs- und Lebensweise hin zu nachhaltigen, kreislauforientierten Modellen, die es ermöglichen, besser im Einklang mit den planetaren Grenzen zu leben – und gleichzeitig unsere Souveränität, Unabhängigkeit und Freiheit zu sichern.
Die Stärkung grundlegender Resilienz für den Erhalt unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaften: durch Bildung, Medienkompetenz, soziales Engagement, Bewusstsein für soziale Ungleichheit – und den Mut, für unsere Werte einzustehen.
Die Neugestaltung einer zukunftsfähigen europäischen Sicherheits- und Verteidigungsinfrastruktur, die nicht isoliert steht, sondern eingebettet ist in unsere gesellschaftlichen Denk- und Handlungsmuster – eine offene, demokratische Gesellschaft, die verteidigungsbereit ist, ohne autoritär zu werden.
Über diese Themen werde ich verstärkt schreiben und reden. In die Lösung dieser Herausforderungen möchte ich mich aktiv einbringen. Und ich werde nach Gleichgesinnten suchen.
Bist du dabei? Bleibst du mit dran?
Und das war es für heute. Bitte leite oder empfiehl den Newsletter doch gerne weiter ➡️ ✉️ - das würde mir sehr helfen. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal!