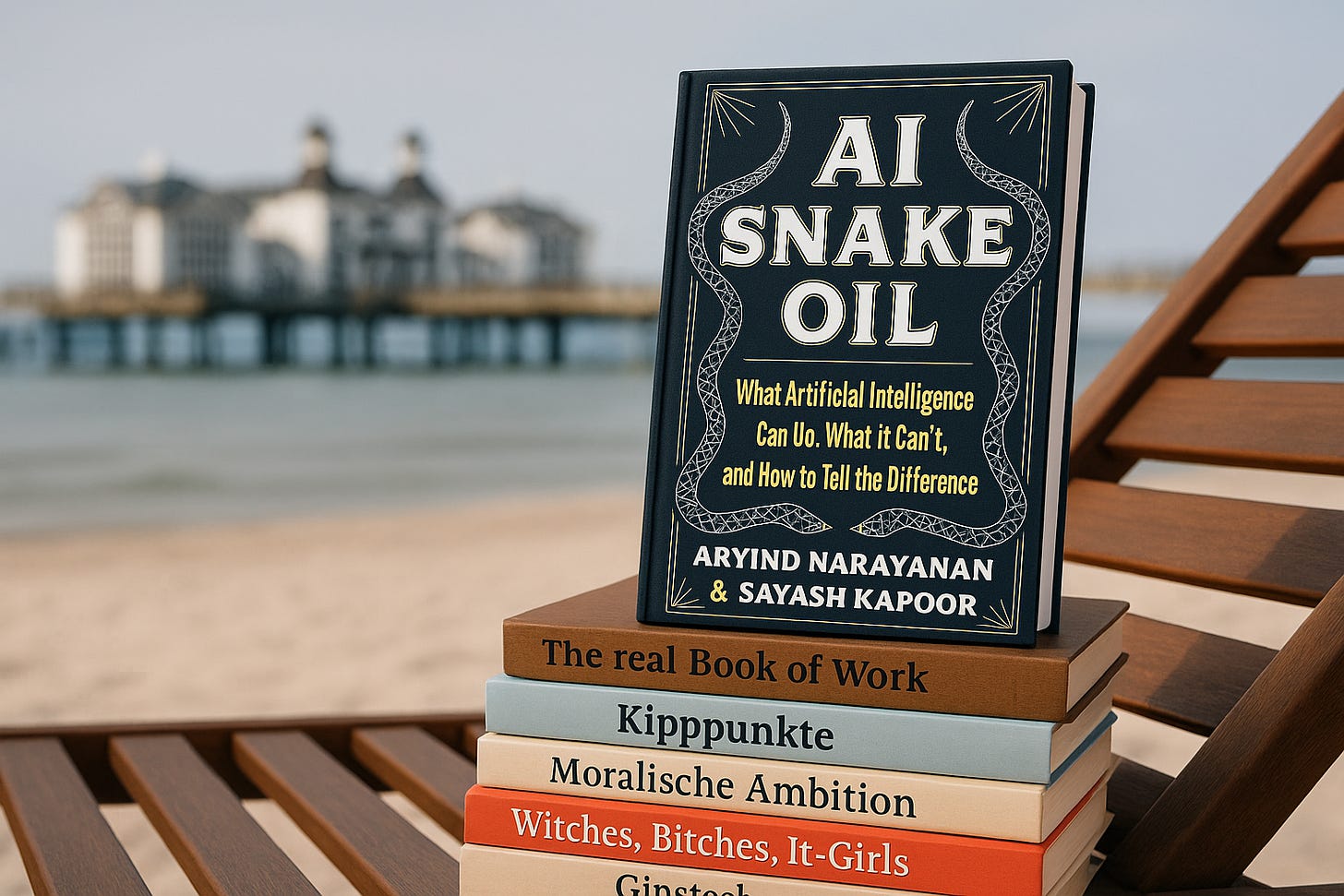📚 #DRANBLEIBEN (Special | Summer Reads)
#158: Sommerlektüre – nicht zum Wegdriften, sondern zum Dranbleiben.
Es gibt Bücher, die liest man durch. Und es gibt Bücher, die lesen einen zurück. Die stellen Fragen, die man im Alltag manchmal vielleicht lieber umschifft. Oder sie liefern Worte für Gedanken, die man schon lange hatte, aber nie so klar fassen konnte. Genau solche Bücher sind in der ersten Jahreshälfte in meinem Lesestapel (das ist natürlich sinnbildlich gemeint… denn jedes Buch war digital…) gelandet und gelesen worden. Und genau solche möchte ich in dieser Sonderausgabe von DRANBLEIBEN, den Summer Reads für die Urlaubszeit, empfehlen.
Es geht um Macht und Systeme. Um Erinnerung und Verantwortung. Um Liebe, Arbeit, Technik und Transformation. Und immer wieder um die Frage, wie wir in dieser Welt eigentlich leben – und wirken – wollen. Und das ganze wird behandelt sowohl in Klassikern als auch in brandneuen Büchern.
Was du hier findest, ist keine alphabetische Liste und auch keine rein thematische Sortierung. Es sind Texte, die hoffentlich nachhaltig Wert stiften, und die nachwirken. Vielleicht werden dich einige ärgern oder zum Widerspruch reizen. Gut so. Denn darum geht’s: Nicht um Zustimmung, sondern um Reibung. Um Weiterdenken. Und um den so wichtigen zweiten Blick.
Also: kein Hochglanz-Sommer-Content. Sondern eine Einladung, beim Lesen nicht nur zur Ruhe zu kommen, sondern auch ein paar Denkbewegungen zu machen. Vielleicht mit Bleistift in der Hand (oder Stylus…). Vielleicht mit einem Knoten im Bauch. Vielleicht mit einer Glühbirne im Kopf. Vielleicht mit einem kleinen Feuer im Herzen. Oder mit allem zugleich… und genau der Art von innerer Bewegung, die dich inspiriert und voranbringt.
Leseempfehlungen aus der ersten Jahreshälfte
Kipppunkte: Von den Versprechen der Neunziger zu den Krisen der Gegenwart (Georg Diez)
Kategorie: Zeitdiagnosen mit Haltung und historischem Langzeitblick / reflektiert, kämpferisch, vielschichtig
Georg Diez ist Journalist, Autor und bekannt für seine streitbaren Analysen zur Zukunft der Demokratie und gesellschaftlichen Transformation. Hier blickt er zurück in die 1990er Jahre. Nicht nostalgisch, sondern kämpferisch. In „Kipppunkte“ nimmt er dieses Jahrzehnt unter die Lupe. Jenes, das nach dem Mauerfall und dem vermeintlichen „Ende der Geschichte“ voller Aufbruchstimmung begann. Und dabei viele Weichen stellte, die unsere Gegenwart bis heute prägen. Diez zeigt, wie sich in dieser Zeit der Neoliberalismus entfaltete, soziale Sicherungssysteme ausgehöhlt wurden, der Klimawandel ignoriert blieb und neue Machtverhältnisse entstanden, deren Konsequenzen wir heute spüren. Nämlich politische Radikalisierung, ökologische Kipppunkte, gesellschaftliche Erschöpfung.
Doch Diez bleibt nicht bei der Analyse stehen. Er fordert dazu auf, die Geschichte nicht als abgeschlossen zu betrachten, sondern als etwas Offenes. Die Kipppunkte, von denen er spricht, sind nicht nur Wendepunkte der Vergangenheit, sondern auch Chancen für die Zukunft. Es geht darum, politische Gestaltungsmacht zurückzugewinnen und neue Narrative zu entwerfe. Und, nicht zuletzt, an Demokratie, Solidarität und Wandel zu glauben. Der Ton ist zugespitzt, die Perspektive vielschichtig. Diez verknüpft Zeitgeschichte mit persönlichen Reflexionen, Politik mit Popkultur, Analyse mit Haltung. Dabei ist ein Buch rausgekommen, das nicht nur erklärt, warum wir da stehen, wo wir stehen, sondern auch fragt: Was wollen wir jetzt tun?
Warum lesen?
Weil das eine phantastisch kurzweilige zeitgeschichtliche Reise ist. Ich habe selten gesehen, dass es so gut gelingt, Analyse und Aufbruch derart klug miteinander zu verbinden. „Kipppunkte“ hat mich nicht nur inhaltlich beeindruckt, sondern auch ermutigt. Nämlich zu denken, zu zweifeln, und vor allem zu gestalten. Diez blickt auf die 1990er Jahre wie auf ein Jahrzehnt voller verpasster Chancen. Aber nicht, um zu resignieren. Vielmehr will er uns zeigen, dass es auch heute noch Alternativen gibt.
Wir haben hier einen Weckruf an alle, die genug haben von der Erzählung, es sei ohnehin zu spät. Zu spät für Demokratie, für soziale Gerechtigkeit, für ein anderes Wirtschaften. Es erinnert daran, dass nichts alternativlos ist. Nicht in der Vergangenheit, und erst recht nicht in der Zukunft.
Wenn du Lust hast, schon mal ganz schnell in diese Gedanken-, Analyse- und Ideenwelt direkt einzutauchen, gibt es hier ein super Gespräch mit Diez im Tilo Jung Podcast Jung & Naiv (hier bei Youtube):
Thinking in Systems - A primer (Donella H. Meadows)
Kategorie: einsteigerfreundliche Systemtheorie für die Weltversteher*innen von morgen / klar, strukturiert, horizonterweiternd
Dieses Buch ist ein Klassiker, und doch passt es derzeit wie kaum ein zweites zu Georg Diez’ „Kipppunkte“ 👆. Was Diez nämlich aus heutiger Sicht akribisch analysiert – die politischen und ökonomischen Fehlentscheidungen der 1990er-Jahre, die uns in viele heutige Krisen geführt haben – findet sich bei Donella Meadows bereits als systemische Frühwarnung vor über 30 Jahren. Denn „Thinking in Systems“ entstand 1993, lange bevor systemisches Denken in der breiten Debatte ankam.
Meadows, eine der führenden Systemtheoretikerinnen des 20. Jahrhunderts und Mitautorin der legendären „Die Grenzen des Wachstums“, konnte das Buch zu Lebzeiten nicht mehr veröffentlichen. Erst 2008, sieben Jahre nach ihrem Tod, wurde es von ihrer Kollegin Diana Wright auf Basis des Originalmanuskripts posthum herausgegeben. Seither gilt es als eines der zugänglichsten und zugleich wirkungsvollsten Werke zur Einführung ins systemische Denken.
Meadows erklärt präzise, was Systeme sind, wie Rückkopplungsschleifen wirken, wie sich „Stocks“ und „Flows“ verhalten. Und warum Systeme oft nicht so reagieren, wie wir es erwarten. Sie macht deutlich, warum gut gemeinte Lösungen scheitern können, wenn sie nur Symptome adressieren. Und sie zeigt, wo sich Hebelpunkte finden lassen. Das sind Stellen, an denen kleine Eingriffe große Wirkung entfalten können.
Das Buch ist anschaulich, klar strukturiert und voller Beispiele, die auch 30 Jahre später verblüffend aktuell wirken. Es ist somit überhaupt gar kein theoretisches Lehrwerk, sondern eine Einladung zur Beobachtung, zum Perspektivwechsel, zur Verantwortung. Und, das sei in aller Deutlichkeit gesagt: Dieses Werk hat vor über 30 Jahren bereits so viel antizipiert, so viele systemische und vor allem toxische Dynamiken offengelegt – und so viele Lösungsansätze formuliert, die wir heute immer noch vor uns herschieben –, dass wir uns als Menschheit fragen müssen, warum wir die richtigen Einsichten so oft erkennen, aber nicht gegen die Beharrungskräfte in Veränderung übersetzen können.
People are afraid of change. They don't trust that a better system is possible. They feel they have no power to demand or bring about improvement. Why are people so easily convinced about their powerlessness? How do they become so cynical about achieving their goals or visions? Why are they so much more likely to listen to people who say they can't make changes than they are to people who say they can?
Warum lesen?
Weil wir die Welt von heute nicht verstehen, geschweige denn gestalten können, ohne systemisch zu denken. Ich beschäftige mich aktuell intensiv mit Systemtheorie, und dieses Buch war für mich ein Muss. Es hat mir geholfen, die Muster hinter komplexen Herausforderungen zu erkennen und besser die Unterschiede zwischen Aktionismus und wirklicher Wirksamkeit zu begreifen. Und wie gesagt, „Thinking in Systems“ ergänzt Diez’ „Kipppunkte“ auf ideale Weise. Denn was bei Diez wie eine historische Rekonstruktion erscheint, liegt bei Meadows als Denkstruktur offen... zu Beginn einer oft unglücklichen Reise. Wenn du verstehen willst, wie unsere Systeme in Wirtschaft, Umwelt, Technologie, Gesellschaft ticken, ist das hier ein super Startpunkt, um nicht nur Antworten, sondern eine neue Art des Sehens zu finden.
Moralische Ambition: Wie man aufhört, sein Talent zu vergeuden und etwas schafft, das wirklich zählt (Rutger Bregman)
Kategorie: Karriereumsteuerungs-Lektüre für Idealist*innen mit Gewissen / provokant, motivierend, pragmatisch
Rutger Bregman ist niederländischer Historiker, Publizist und Bestsellerautor (Utopien für Realisten, Im Grunde gut), bekannt für seine pointierten Analysen zu sozialer Gerechtigkeit und Zukunftspolitik. In seinem neuesten Buch richtet er sich an Menschen mit Bildung, Ressourcen und Gestaltungsspielraum. Und stellt eine sehr unbequeme Frage: Warum arbeiten so viele von ihnen in Berufen, die weder gesellschaftlich relevant noch zukunftsfähig sind? Unter dem Begriff „moralische Ambition“ versteht er den Willen, das eigene Leben und die eigene Karriere auf das auszurichten, was langfristig wirklich zähle. Nämlich soziale Gerechtigkeit, globale Gesundheit, Klimaschutz, Demokratie. Er zeichnet historische Beispiele von Menschen, die sich für diese Ziele eingesetzt haben – von Abolitionist*innenen über Bürgerrechtler*innen bis hin zu Klimaaktivist*innen – und zeigt, was wir heute aus ihren Kämpfen lernen können. Er kritisiert die Verschwendung von Talent in so genannten Bullshit-Jobs, die nichts zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beitrügen, und plädiert dafür, dass mehr Menschen ihre Fähigkeiten in den Dienst des Gemeinwohls stellen sollten. Und dabei bleibt er nicht abstrakt. Denn er liefert konkrete Strategien, wie sich Idealismus mit Wirksamkeit verbinden lässt. Und wie man trotz komplexer Realitäten ins Handeln kommt. Stilistisch wechselt Bregman zwischen historischer Analyse, persönlicher Ansprache und pragmatischer Anleitung. Das Ergebnis ist ein engagierter, argumentativ dichter Text, der zur Selbstreflexion einlädt.
Warum lesen?
Mich hat das Buch in einem Moment erwischt, in dem ich selbst sehr umfangreich über Wirkung, Verantwortung und Selbstverortung nachdenke. Gerade für Menschen, die mit Privilegien ausgestattet sind – sei es durch Bildung, finanzielle Sicherheit oder Netzwerke – stellt es eine zentrale Frage: Nutze ich das, was ich kann, für etwas, das zählt? Besonders hilfreich finde ich, dass Bregman moralische Ambition nicht als hehre Idee inszeniert, sondern als eine Haltung, die mit Komplexität umgehen kann. Mit Pragmatismus, Ausdauer und der Bereitschaft, nicht perfekt zu sein. Auch wenn ich nicht jede Zuspitzung teile (die individuelle Perspektive ist manchmal recht dominant), hat das Buch mich weitergebracht. Weil es Argumente liefert, statt Appelle.
The Real Book of Work: Organisationen in Not. Warum wir umdenken müssen, um sie in die Zukunft zu führen (Christina Grubendorfer, Christina Ackermann)
Kategorie: Systemtheorie trifft Führungsmythen / entlarvend, praxisnah, unbequem
Organisationen funktionieren nicht so, wie viele gern glauben. Und sie lassen sich auch nicht „einfach“ transformieren, indem man Silos abschafft, Hierarchien flachklopft oder ein agiles Mindset herbeicoacht. Genau hier setzt „The Real Book of Work“ an. Ein kluges, humorvolles und pointiertes Buch, das systemtheoretisches Denken in die Praxis der Organisationsgestaltung übersetzt. Grubendorfer und Ackermann, beide erfahrene systemische Organisationsberaterinnen und Transformationsexpertinnen, räumen mit gängigen Management-Mythen auf und zeigen, warum Organisationen komplexe, eigenlogische Systeme sind. Und keine Maschinen, keine Familien, keine Feelgood-Fabriken. Statt einfacher Erfolgsrezepte liefern sie einen systemischen Blick auf Struktur, Paradoxie und Steuerungslimitationen. Zentraler Bestandteil des Buchs sind neun gängige Führungs- und Organisationsmythen, die kenntnisreich seziert werden: von „Mehr Eigenverantwortung bitte!“ bis „Der schreiende Chef muss weg!“ oder „Schafft die Hierarchie ab!“. Dazu gibt’s kluge Illustrationen, praktische Impulse und vor allem eine Ermutigung zum ernsthaften Nachdenken über Wirkung, Funktion und Veränderung in Organisationen.
Warum lesen?
Weil das ein sehr wertvolles unbequemes Buch ist. Ich schätze und empfehle „The Real Book of Work“, weil es viele liebgewonnene New-Work-Glaubenssätze infrage stellt. Da ist eine Menge „kill your darlings“ Stoff dabei… gerade wenn man – wie ich – grundsätzlich progressive Entwicklungen in der Arbeitswelt befürwortet. Aber genau das macht das Buch für mich so wertvoll. Es zwingt dazu, eigene Überzeugungen zu überprüfen, blinde Flecken zu erkennen und sich der Frage zu stellen, ob unsere gut gemeinten Ideen tatsächlich zur Funktionslogik von Organisationen passen. Mich hat nicht alles überzeugt, aber das muss es auch nicht. Aber es hat mich zum Nachdenken gebracht. Und ein Thema hat mich besonders beschäftigt: die These, dass wir nicht „der ganze Mensch bei der Arbeit“ sein sollten. Darüber denke ich noch nach. Und genau deshalb wird es dazu bald eine eigene DRANBLEIBEN-Denkanstoß-Ausgabe geben.
Unverdiente Ungleichheit: Wie der Weg aus der Erbengesellschaft gelingen kann (Martyna Linartas)
Kategorie: Systemkritische Gesellschaftsanalyse mit politischem Biss / aufwühlend, argumentativ, streitbar
Deutschland ist ein reiches Land. Doch unser Reichtum ist höchst ungleich verteilt. In kaum einem anderen westlichen Staat entscheidet so sehr die Geburt in die „richtige“ Familie über Zugang zu Vermögen, Chancen und gesellschaftlichem Einfluss. Martyna Linartas nennt dieses System treffend eine Erbengesellschaft. Sie legt in diesem Buch schonungslos offen, wie tief diese strukturelle Ungleichheit in unserem politischen und wirtschaftlichen Gefüge verankert ist.
Ihre Analyse stützt sich auf Daten, historische Vergleiche und Interviews mit Mitgliedern der Wirtschaftselite, die überraschend offen über ihr Verhältnis zu Reichtum sprechen. Linartas zeigt, dass die extrem ungleiche Verteilung von Betriebsvermögen und Erbschaften nicht naturgegeben ist. Sie ist ganz bewusst politisch geebnet worden – und wurde über Jahrzehnte hinweg durch Steuerpolitik, Lobbyinteressen und rechtliche Schlupflöcher stabilisiert.
Wer vorher Thinking in Systems von Donella Meadows 👆 gelesen hat, erkennt hier die systemische Dynamik wieder: In einem entsprechend designten (oder nicht bewusst designten) System werden die Gewinner*innen jeder Runde automatisch in eine noch bessere Position versetzt, um auch die nächste Runde zu gewinnen… und die nächste, und die übernächste. Linartas beschreibt nun den Zustand, in dem sich unser System nach vielen solcher Runden befindet. Und er ist, wenig überraschend: verfestigt und hochproblematisch.
Sie warnt eindringlich vor den demokratiegefährdenden Folgen dieser Entwicklung und fordert einen Paradigmenwechsel. Eine gerechte Besteuerung großer Vermögen, eine Rückbesinnung auf das Gemeinwohl, eine aktivere Rolle des Staates. Steuern, so ihre zentrale These, seien keine Last, sondern ein Hebel für eine gerechtere Gesellschaft.
Warum lesen?
Ich hatte ein sehr hörenswertes Interview mit Linartas in meinen kürzlich verteilten Podcast-Empfehlungen. Dort geht es um dieses Buch, weshalb es in meiner Empfehlungsliste nicht fehlen darf. Ich finde es so besonders lesenswert, weil Linartas hier ein Tabu bricht, das das Gerechtigkeitsempfinden vieler Menschen seit Jahren untergräbt. Aber selten wurde das so präzise in Worte gefasst. Es liefert Argumente, die man braucht, um gegen das Mantra „Leistung muss sich lohnen“ die Frage zu stellen: Wessen Leistung eigentlich? Und warum in einem der reichsten Länder der Welt jeder sechste Mensch arm bleibt?
Das Buch ist temperamentvoll, humorvoll und argumentativ stark. Einzig - aber das liegt nicht an Linartas - aber frage ich mich, wie wahrscheinlich die Realisierbarkeit der vorgeschlagenen Lösungen ist. Denn die Beharrungskraft bestehender Machtstrukturen ist enorm. Ich habe Zweifel, ob wir diese jemals überwinden können. Aber wenn du dich für soziale Gerechtigkeit interessierst oder einfach verstehen willst, warum Deutschland in zentralen Fragen der Vermögensverteilung stagniert, dann solltest du dieses Buch lesen.
Und wo strukturelle Gerechtigkeit an ihre Grenzen stößt, braucht es vielleicht etwas noch Fundamentaleres: eine gemeinsame Vorstellung davon, wie wir in Beziehung zueinander stehen wollen… 👇
All About Love: New Visions (bell hooks)
Kategorie: Grundlagenliteratur über Liebe als politische Praxis / tiefgründig, fordernd, transformativ
bell hooks – US-amerikanische Feministin, Autorin und Sozialkritikerin – legte mit All About Love ein Buch vor, das man nicht nur als Klassiker feministischer Theorie, sondern auch als gesellschaftliches Grundlagenwerk lesen kann. Ursprünglich 2001 erschienen, analysiert sie darin, warum wir in einer Kultur leben, die zwar ständig über „Liebe“ spricht, aber selten wirklich klärt, was damit gemeint ist. hooks dekonstruiert gängige Liebesvorstellungen und zeigt, wie patriarchale Strukturen und emotionale Unreife unsere Beziehungen verzerren. Und sie formuliert eine neue Ethik der Liebe: als bewusste Praxis, die auf Respekt, Verantwortung, Vertrauen, Fürsorge und Kommunikation basiert.
Was dieses Buch besonders macht: Es denkt Liebe nicht nur im privaten Raum, sondern in allen gesellschaftlichen Kontexten. Auch in Freund*innenschaften, Familie, Bildung, Politik und Arbeitswelt (! - Donnerwetter). Dabei stützt sich hooks u.a. auf M. Scott Pecks Definition von Liebe als „willentliche Entscheidung, das eigene und das spirituelle Wachstum anderer zu fördern“. hooks ist in diesem Thema und der Auslegung des Buchs sehr engagiert, fordernd und gleichzeitig sehr persönlich. Eine vereinnahmende Mischung aus soziologischer Analyse, autobiografischer Reflexion und spiritueller Tiefe.
Warum lesen?
Empfohlen hat mir das Buch Maximilian – und ich bin sehr dankbar dafür. Denn All About Love gehört zu diesen Büchern, die einen ganz sicher weiter begleiten werden. So wie Thinking in Systems von Donella Meadows (siehe oben 👆) ist auch dieses Buch seiner Zeit weit voraus gewesen. Oder vielleicht ist es einfach so, dass die Zeit den wirklich klugen Ideen und Denker*innen immer wieder hinterherhinkt. 😉
Was mich besonders bewegt hat: hooks’ Fähigkeit, ein so großes und oft kitschig aufgeladenes Thema wie „Liebe“ mit einer analytischen Schärfe auseinanderzunehmen. Und es trotzdem gleichzeitig radikal menschlich zu halten. Dass sie auch die Arbeitswelt mitdenkt, mag für viele überraschend sein. Aber es ist ein sehr wertvoller Aspekt. Denn auch bei der Arbeit, in Arbeitskontexten und in unseren professionellen Rollen fehlen uns oft klare Vorstellungen davon, wie ein liebevoller – im Sinne von fürsorglicher, verantwortlicher, ehrlicher – Umgang miteinander eigentlich aussehen kann. In diesem Sinne ist das Buch auch ein Kompass in Richtung eines romantischeren und menschenfreundlicheren Business… so wie es Tim Leberecht und Till Grusche beim House of Beautiful Business kultivieren. Ich war in diesem Jahr erstmals beim jährlichen Festival in Tanger und trage viele der Begegnungen, Gedanken und Stimmungen immer noch mit mir. (hier findest du einen ausführlichen Bericht)
Die nächsten drei Bücher 👇 führen uns an dunklere Orte: historisch, familiär, gesellschaftlich. Aber auch hier geht es letztlich um Beziehung, Verantwortung und die Frage: Wie hätte ich gehandelt? Wie handle ich heute?
Ginsterburg (Arno Frank)
Kategorie: still erzählter Mitläufer-Roman über die Banalität des Bösen / leise, beklemmend, literarisch dicht
„Ginsterburg“ erzählt die Geschichte einer fiktiven deutschen Kleinstadt zwischen 1935 und 1945. Und damit auch die Geschichte unseres ganzen Landes in Zeiten der Verführung, Verrohung und Zerstörung. Mit diesem Roman nähert sich Frank dem Nationalsozialismus nicht über das große Drama, sondern über den Alltag. Wie schleicht sich das Regime in Buchhandlungen, Wohnzimmer und Blumengeschäfte? Wie verändert es Familien, Freundschaften und Karrieren?
Im Zentrum stehen Menschen wie die einer Buchhändlerin, deren Sohn in der Hitlerjugend Halt sucht. Oder ein Journalist, der zwischen Gewissen und Anpassung schwankt. Oder jemand, der Blumen verkauft… und seine Karriere. Die multiperspektivische Erzählweise führt durch drei Zeitschnitte (1935, 1940, 1945) und macht erfahrbar, wie aus stiller Zustimmung langsam immer mehr Mitläufertum wird. Und aus diesem Mitläufertum am Ende ein System.
Frank verzichtet bewusst auf moralische Kommentare und klassische Identifikationsfiguren. Er lässt die Sprache, Atmosphäre und Konstellationen sprechen. Er erschafft so ein vielschichtiges Bild einer Gesellschaft, die sich dem Totalitarismus nicht entgegenstellt, sondern sich in ihm einrichtet. „Ginsterburg“ ist keine Heldengeschichte, sondern eine Geschichte der leisen, alltäglichen Katastrophe.
Warum lesen?
Weil dieser Roman zeigt, wie Geschichte wirklich passiert. Nämlich nicht in den Schlagzeilen, sondern in kleinen Gesten, Bequemlichkeiten, Ausreden. Mich hat das Buch deshalb tief beeindruckt, weil es eben nicht laut oder didaktisch ist, sondern leise, genau und beklemmend realistisch. Es ist ein Buch über das Mitlaufen, über das Wegsehen, über den schleichenden Verlust von Anstand. Gerade in Zeiten, in denen Demokratie und Menschenrechte bei uns, heute, erneut unter Druck stehen, ist Franks Roman eine literarische Erinnerung daran, wie schnell es gehen kann. Und wie viel Verantwortung im Alltäglichen liegt. Wenn du dich für Erinnerungskultur interessierst, für die Grauzonen zwischen Schuld und Ohnmacht oder einfach einen gut arrangierten, eindrucksvoll geschriebenen Roman lesen willst, dann solltest du dieses Buch in Erwägung ziehen.
Mein Großvater, der Täter: Eine Spurensuche (Lorenz Hemicker)
Kategorie: familiäre Vergangenheitsbewältigung als politische Spurensuche / schonungslos, persönlich, gesellschaftlich relevant
Was Arno Frank in „Ginsterburg“ literarisch erzählt – wie sich das Grauen des Nationalsozialismus langsam in den Alltag einer Kleinstadt einschleicht –, das findet hier seine bedrückende Entsprechung in der Realität. In „Mein Großvater, der Täter“ rekonstruiert Lorenz Hemicker die Geschichte seines Großvaters Ernst Hemicker. SS-Offizier und Tiefbauingenieur, der 1941 die Gruben für das Massaker von Rumbula bei Riga anlegen ließ. Ein Ort, an dem mehr als 27.000 Jüdinnen und Juden ermordet wurden. Was folgt, ist eine persönliche wie gesellschaftlich relevante Spurensuche: Nach dem Tod seines Vaters beginnt Hemicker zu recherchieren. Er reist nach Lettland, führt Gespräche mit Überlebenden, arbeitet sich durch Akten und Archive. Was ihn dabei antreibt, ist nicht nur das Bedürfnis nach Aufklärung, sondern die bohrende Frage: Wie konnte aus einem Familienmitglied ein Täter werden… und warum wurde darüber geschwiegen?
Das Buch ist mehr als eine private Aufarbeitung. Es zeigt, wie familiäre Narrative um Schuld und Verantwortung über Generationen weitergegeben (oder unterdrückt) werden. Und es macht deutlich, dass das Schweigen nach 1945 ein zweites Verbrechen war. Eines, das sich tief in die deutsche Nachkriegsgesellschaft eingeschrieben hat.
Warum lesen?
Weil dieses Buch den Schritt von der Fiktion zur Wirklichkeit macht. Nach der literarischen Annäherung in „Ginsterburg“ folgt hier die Konfrontation mit konkreter historischer Schuld, innerhalb der eigenen Familie. Und gerade das macht Hemickers Spurensuche so eindrucksvoll. Sie ist keine Heldengeschichte, sondern ein tastendes, ehrliches Ringen mit Verantwortung und Erinnerung. Mich hat das Buch nicht nur persönlich berührt, sondern auch nochmal auf eine andere Art und Weise wachgerüttelt. Weil es zeigt, wie tief die Verbrechen und die Ideologie der NS-Zeit in unsere Gegenwart reichen. Und in meinem Fall - und da bin ich sicher nicht allein - reicht es eben auch bis in die Großvater-Generation. Und dort ist es eben nicht nur politisch, sondern biografisch, familiär, emotional. Erinnerung funktioniert nicht nur durch die Geschichten der Opfer. Sondern auch durch den Blick auf die Täter. Und durch die Bereitschaft, diesen Blick auszuhalten. Und dem kann man sich hier wahrhaft aussetzen.
The Last American Road Trip: A Memoir (Sarah Kendzior)
Kategorie: politische Familien-Essays aus einem zerfallenden Land / intim, analytisch, melancholisch
Was Ginsterburg literarisch nachzeichnet und Lorenz Hemicker biografisch aufarbeitet – nämlich, wie sich autoritäre Systeme in das Leben einzelner einschreiben, wie sie Normalität kapern und Verantwortung zersetzen – das greift Sarah Kendzior in The Last American Road Trip auch auf. Jedoch mit Blick auf die Gegenwart. Nicht das Dritte Reich, sondern das heutige Amerika ist ihr Untersuchungsgegenstand. Und wieder steht am Anfang eine Ahnung dass etwas Grundlegendes verloren geht. Und dass es sich lohnt, genau hinzusehen, bevor es zu spät ist.
Kendzior ist Politikwissenschaftlerin, Bestsellerautorin und eine der schärfsten Kritikerinnen des demokratischen Verfalls in den USA. In ihrem neuen Buch verbindet sie politische Analyse mit persönlicher Erinnerung. Und mit einer Reise, die alles andere als gewöhnlich ist. Getrieben vom Gefühl, ihren Kindern noch das „alte Amerika“ zeigen zu müssen, bevor es endgültig verschwindet, bricht sie mit ihrer Familie zu einem Roadtrip quer durchs Land auf. Nationalparks, schräge Attraktionen, historische Orte: Die Stationen dieser Reise werden zu Spiegeln amerikanischer Geschichte. Und ihrer Risse.
Das Buch ist episodisch, vielschichtig und stilistisch mitunter ungewöhnlich. Es wechselt zwischen intimen Familienmomenten, analytischen Reflexionen und dann schmerzhaft klaren politischen Diagnosen. Kendzior zeigt ein Land zwischen Schönheit und Abgrund. Und eine Mutter, die ihren Kindern erklärt, warum Hoffnung manchmal wie Widerstand aussieht.
Warum lesen?
Weil Kendzior hier etwas sehr Eigenes gelingt. Sie bringt das Intime und das Politische zusammen. Das Familiäre und das Gesellschaftliche. Das Nostalgische und das Zornige. In einen einzigen, kurzweiligen Erzählstrom. Dieses Buch hat mich nachdenklich und traurig gemacht, weil es die Frage stellt, wie man seinen Kindern Hoffnung beibringt, in einem Land, das sich selbst verliert. Kendzior zeigt, was es heißt, sich zu erinnern, bevor das Erinnern selbst verschwindet. Und dass Erinnerung – in welcher Form auch immer – nicht Rückblick ist, sondern Widerstand. Das Buch ist für alle, die sich für politische Zeitdiagnostik mit Haltung interessieren. Und für Menschen mit einer brüchigen, aber hartnäckigen Liebe zu den USA.
AI Snake Oil: What Artificial Intelligence Can Do, What It Can't, and How to Tell the Difference (Sayash Kapoor, Arvind Narayanan)
Kategorie: KI-Realismus für politisch interessierte kritische Denker*innen / präzise, ernüchternd, gesellschaftlich relevant
Hast du dich gefragt, wo denn KI-Lektüre bleibt? Hier ist sie. Wenn du ein KI-Buch dieses Jahr liest, sollte es aus meiner Sicht dieses hier sein. Denn wer diesen Newsletter liest, hat sich mit KI längst mehr als oberflächlich beschäftigt. Nämlich auch mit ethischen Fragen, gesellschaftlichen Folgen und politischen Dimensionen. „AI Snake Oil“ bietet genau dafür die passende Vertiefung. Das Buch stammt von zwei Informatikern der Princeton University, die nicht bloß erklären, wie KI funktioniert, sondern aufdecken, wie sie falsch eingesetzt, überhöht oder missverstanden wird.
Kapoor und Narayanan nehmen sich vor, die Kluft zwischen Hype und Realität zu vermessen. Sie zeigen, wie KI-Systeme in sensiblen Bereichen wie Bildung, Medizin, Justiz oder Personalwesen eingesetzt werden, oft ohne ausreichende Transparenz, Wirksamkeit oder Fairness. Statt düsteren Fantasien über Superintelligenzen geht es ihnen um konkrete Herausforderungen: diskriminierende Algorithmen, schlechte wissenschaftliche Praxis, Machtkonzentration bei Tech-Konzernen. Mit Fallbeispielen, technischer Klarheit und gesellschaftlicher Perspektive ist das Buch ein scharfes Gegenmittel zu blinder Technologiegläubigkeit. Und eine Einladung zu kritischer Differenzierung. Für alle, die sich für eine aufgeklärte, verantwortungsvolle Auseinandersetzung mit KI interessieren, ist „AI Snake Oil“ ein unverzichtbarer nächster Schritt.
Warum lesen?
Weil wir in einer Zeit leben, in der man KI ganzheitlich verstehen muss, um nicht zum Spielball von Unternehmen, Mythen und Marketing zu werden. „AI Snake Oil“ hat mich begeistert, weil es weder alarmistisch noch euphorisch ist, sondern ziemlich klar, ehrlich und faktenbasiert. Es ist ein Gegenmittel gegen Tech-Geblubber. Und eine Anleitung, wie man echte Innovation von gefährlicher Blenderei unterscheiden kann. Wenn du dich für digitale Ethik interessierst, für Technologie im Alltag, für die politische Dimension von Code, dann wirst du dieses Buch mit Gewinn lesen. Es ist nicht nur für Entwickler*innen oder Expert*innen geschrieben, sondern für alle, die sich eine aufgeklärte Haltung gegenüber KI erarbeiten wollen.
Witches, Bitches, It-Girls. Wie patriarchale Mythen uns bis heute prägen (Rebecca Endler)
Kategorie: Patriarchatskritik mit Popkultur-Tiefgang und ironischem Biss / bissig, belesen, brennend aktuell
Wenn du regelmäßig DRANBLEIBEN liest, und vor allem frühere Buch-Empfehlungsausgaben gelesen hast, wirst du dich vielleicht schon gewundert haben, wo eindeutig feministische Literatur bleibt. Voilà! Denn das darf nicht fehlen… schließlich lassen sich in meinen Augen alle der bisher genannten gesellschaftlichen Herausforderungen bis auf eine Ursprungswurzel zurückverfolgen: das Patriarchat und patriarchale Machtstrukturen. Wenn wir die nicht überwinden, schaffen wir es nicht. Und deshalb darf diese wichtige Buchempfehlung hier nicht fehlen!
Rebekka Endler – Journalistin, Bestsellerautorin (Das Patriarchat der Dinge) und Co-Host des empfehlenswerten Podcasts Feminist Shelf Control (mit Annika Brockschmidt) – hat hier mit Witches, Bitches, It-Girls ein ebenso wütendes wie wahnsinnig unterhaltsames Buch geschrieben. Es geht um Geschichten, die seit Jahrhunderten über Frauen erzählt werden. Genauer: über die falschen Frauen. Die unbequemen, zu lauten, zu mächtigen, zu schönen, zu freien. Also um Hexen, Furien, Bitches und It-Girls. Endler spürt den Ursprüngen dieser Bilder nach, zeigt, wie sie sich kulturell überall abgelagert haben, von der Romantik bis TikTok, und legt offen, mit welchem Zweck sie eingesetzt werden. Nämlich um Frauen zu disziplinieren, einzuschränken, zu marginalisieren. Ob True-Crime-Podcast, Kunstkanon oder Mommyblog, Endler zeigt, wie sich patriarchale Narrative quer durch Popkultur, Medien und Alltagswahrnehmung ziehen. Dabei stellt sie die Frage, was eigentlich als „normal“ gilt. Und vor allem, wer davon profitiert. Inhaltlich führt das Buch durch feministische Bewegungen, kulturelle Archetypen, Mythen und neue und alte Rollenbilder. von Influencerinnen bis Tradwives. Es ist eine ganz besondere Mischung aus wissenschaftlicher Fundierung, persönlicher Perspektive, Ironie und Klartext.
Warum lesen?
Ich bin großer Fan von Feminist Shelf Control … und war entsprechend neugierig auf Endlers neues Buch. Erwartung: scharf, bissig, durchdacht. Ergebnis: all das, und noch mehr. Und dabei wahnsinnig gut unterhaltend. „Witches, Bitches, It-Girls“ passt auch thematisch perfekt in diese Sonderausgabe von DRANBLEIBEN. Denn genau wie Georg Diez in Kipppunkte oder Donella Meadows in Thinking in Systems zeigt Endler, dass viele der Herausforderungen, mit denen wir heute gesellschaftlich ringen, überhaupt nicht neu sind. Sondern systemisch und tief eingefressen in alle gesellschaftlichen Strukturen. Und dass wir sie nur verstehen (und verändern) können, wenn wir die alten Erzählungen erkennen, die sie immer noch mit antreiben. Für mich persönlich ist dieses tolle Buch ein bereichernder, manchmal zorniger, aber immer sehr kluger Text. Und ein gutes Gegengift gegen den Mythos, wir hätten „das Patriarchat“ doch längst überwunden (🙄). Wenn du mehr darüber lernen willst, wie tief kulturelle Bilder wirken, warum Normalität immer auch Macht ist, und was es braucht, um dem etwas entgegenzusetzen: unbedingt lesen!
Und wenn du in Köln oder Umgebung lebst und am 16.9.25 noch nichts vorhast, dann könnte diese Lesung hierzu mit Rebekka Endler und Annika Brockschmidt vielleicht interessant für dich sein! 📖
Was bleibt?
Ob Systemwandel, Erinnerungskultur, Arbeitswelt oder Zukunftstechnologie, all diese Bücher zeigen auf unterschiedliche Weise, dass wir es nicht mit Naturgewalten zu tun haben. Sondern mit menschengemachten Strukturen, Entscheidungen, Narrativen. Und genau deshalb können wir auch etwas verändern. Nicht alles auf einmal. Aber Schritt für Schritt. Perspektive für Perspektive.
Die Fragen sind komplex, die Antworten selten bequem. Aber genau darin liegt die Chance. Im genauen Hinschauen. Im Aushalten. Im Hinterfragen. Und im gemeinsamen Weiterdenken.
In diesem Sinne: Danke fürs Mitlesen, Mitdenken, Mitfühlen. Und fürs Dranbleiben! Und wenn du magst, schreib’ mir doch deine Gedanken zur dieser Ausgabe… vielleicht auch deine eigenen Buch-Empfehlungen:
Bitte leite oder empfiehl meinen Newsletter gerne weiter ➡️ ✉️ - das würde mir sehr helfen. Danke dir für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal!